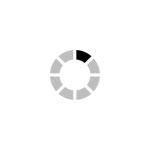Das Taublatt (Drosophyllum lusitanicum) ist eine fleischfressende Pflanze aus der Familie der Taublattgewächse. Das natürliche Verbreitungsgebiet ist Portugal und die südliche Region Spaniens. Auch aus dem nördlichen Marokko sind einige kleine Populationen bekannt. Dort findet man das Drosophyllum in lichten Pinien- oder Korkeichenwäldern auf leicht saurem bis neutralem, meist sandigen oder steinigen Boden.

Die botanische Einordnung des Taublatts früher und heute
Die erste Beschreibung von Drosophyllum lusitanicum erfolgte 1661 von Gabriel Grisley in seinem Werk „Viridarium Lusitanum“. Dort beschrieb er diese Pflanze als „chamaeleontioides“. 1689 beschrieb J. P. de Tournefort die Pflanze als „Ros solis lusitanicus maximus“, den großen portugiesischen Sonnentau, der somit zur schon bekannten Gattung Drosera gehörte. Als 1753 Carolus Linnaeus sein System der modernen botanischen Nomenklatur erstellte, beschrieb er Drosophyllum als Drosera lusitanica und stellte Drosophyllum ebenfalls in die Gattung Drosera.
1806 trennte Heinrich Friedrich Link die Art aus der Gattung Drosera heraus und klassifizierte eine eigene Gattung Drosophyllum mit der einzigen Art Drosophyllum lusitanicum. Erst 1989, zum Fall der innerdeutschen Mauer, stellten Chrtek, Slavikóva und Studnička das Drosophyllum in eine eigene Familie der Drosophyllaceae (Taublattgewächse). Aufgrund ihrer Morphologie und auch nach späteren genetischen Untersuchungen ist das Drosophyllum nicht näher mit den anderen Vertretern aus der Familie der Droseraceae (Sonnentaugewächse) verwandt. Die nächsten Verwandten stammen aus den Dioncophyllaceae – das Hakenblatt, Triphyophyllum peltatum – und den Nepenthaceae, den Kannenpflanzen.
Der botanische Name des Taublatts leitet sich aus dem Griechischen ab: „drosos“ bedeutet Tau, „phyllon“ steht für Blatt, deshalb der deutsche Name „Taublatt“, was übrigens auch die Bezeichnung für die Fachzeitschrift der Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen im deutschsprachigen Raum – G.F.P. e. V. – ist. Der Artname „lusitanicum“ leitet sich von der altrömischen Provinz Lusitania ab, die große Teile des heutigen Portugal umfasste.
Erste Kulturerwähnungen gehen auf Charles Darwin zurück, der im März 1869 getopfte Wildexemplare von seinem Freund Georg Maw aus Portugal geschickt bekam. Er kultivierte diese Drosophyllum Pflanzen erfolgreich für mehrere Jahre und veröffentlichte seine Ergebnisse und Erkenntnisse 1875 in seinem berühmten Buch „Insectivorous Plants“ (Darwin 1975).
Beschreibung des Drosophyllums
Das Wurzelsystem von Drosophyllum ist stark ausgeprägt, es ist ein sehr tief wachsender Pfahlwurzler mit vielen Verästelungen, um auch bei der dort herrschenden Trockenheit noch an genügend Feuchtigkeit zu kommen.
Die Blütezeit liegt von März bis Mai, dann entstehen bis zu 20 Einzelblüten (durchschnittlich meist 5 bis 10 Blüten) an einem gemeinsamen Blütenstengel. Die recht großen, schwefelgelben, fünfblättrigen Blüten erreichen einem Durchmesser von 2,5-4 cm. Die Blütenstengel erreichen eine Höhe von 50 cm und mehr und stehen weit über der eigentlichen Pflanze, wohl um das Fangen der Bestäuberinsekten zu verhindern.
Auch der Stengel und die Kelchblätter der Blüte sind mit den karnivoren Drüsenhaaren besetzt. Nach nur wenigen Stunden oder Tagen vertrocknen die Blütenblätter und die Samenkapsel mit ihren 5-10 großen, schwärzlichen Samen wächst heran. Drosophyllum ist auch selbstbestäubend.
Die leicht durchscheinende Samenkapsel erinnert an eine kleine Pyramide und besteht aus 5 silbrigen Blättern des Ovariums. Sie öffnet sich bei Reife der Samen am oberen Ende. Von oben betrachtet ähnelt die geöffnete Samenkapsel dann einem 5-zackigen, silbernen Stern. Da die geöffneten Samenkapseln senkrecht nach oben stehen, wird von Wind und Regen im Laufe der Zeit nur hier und da ein Samenkorn heraus geweht. Nach über einem Jahr sind immer noch Samen in den Samenkapseln vorhanden.
Die leicht tropfenförmigen, hartschaligen, ca. 2,5 mm großen Samen sind gut gegen Feuer geschützt und keimen meist nach einem Feuer bei feuchten Bedingungen im Winter. Nach der Keimung wächst Drosophyllum sehr schnell zu stattlichen Pflanzen mit bis zu 30 cm langen, hellgrünen, fadenförmigen Blättern heran. Das Drosophyllum gilt als Erstbesiedler. Nach einem Feuer, nach Rodung, Pflügen oder Erdabbruch wächst sie mit als erstes schnell heran, wenn Samen im Boden liegen. Die Samen behalten für mehrere Jahre ihre Keimfähigkeit.
Blühfähig sind die Pflanzen erst im zweiten Jahr. Nach der Blüte vertrocknet der blühende Trieb und aus einigen alten Blattachseln entstehen neue Wachstumspunkte. Das Drosophyllum verästelt sich mit mehreren Spitzen und im Laufe der Jahre können so stattliche Büsche mit Dutzenden von Triebspitzen entstehen. Der Stamm der Pflanze verholzt mit der Zeit und kann fingerdick werden. Laut Literatur kann das Drosophyllum 8 Jahre alt werden (McPherson 2010).
Das Taublatt produziert rosettig angeordnete, bis ca. 30 cm lange, linearische Blätter, die einen kantigen Querschnitt und eine gerillte Blattoberfläche besitzen. Ungewöhnlich ist, dass die Blattknospen nicht nach innen, sondern nach außen eingerollt sind. Die entstehenden Blätter wachsen aufwärts gerichtet und zeigen erst in zunehmendem Alter in die Horizontale. Wenn die Blätter diese Position erreicht haben, beginnen sie nach einiger Zeit von der Spitze her langsam abzusterben und sich entgegen der Sprossachse nach unten zu krümmen.

Die abgestorbenen, grau-schwarzen Blätter fallen nicht ab, sondern umschließen buschig den Stamm der Pflanze unterhalb der Wachstumszone. Das abgestorbene Blattwerk soll stark UV-reflektierend sein und somit zusätzlich Beuteinsekten anlocken. Auch dienen die abgestorbenen Blätter möglicherweise der Unterdrückung konkurrierender Vegetation.
Die Drosophyllum-Blätter sind mit zwei unterschiedlichen Arten von Drüsen besetzt. Sofort sichtbar sind die sehr kurz gestielten, roten Fangdrüsen (Fangtentakel), die ein klebriges, durchsichtiges Sekret absondern, an dem sich ihre Beute-Insekten verfangen und kleben bleiben. Das Sekret hat eine hohe Viskosität, zieht Fäden wie ein Klebstoff und scheint hydrophob, d. h. Wasser abweisend, zu sein. Auch bei starkem Regen werden die Klebetropfen nicht von den Blättern gewaschen.
Direkt auf der Blattoberfläche sitzen in mehreren Reihen die meist farblosen, durchsichtigen Verdauungsdrüsen. Am Standort und bei starker Sonneneinstrahlung färben sich diese Verdauungsdrüsen ebenfalls rötlich und sind dann sehr gut zu erkennen. Die Verdauungsdrüsen produzieren die Verdauungsenzyme (z.B. Esterasen, Phosphatasen, Proteasen etc.). Es sitzen 5-10 mal mehr Verdauungsdrüsen auf der Blattoberfläche als Fangtentakel.
Anders als bei vielen anderen karnivoren Pflanzen mit Klebfallen ist das Drosophyllum eine passive Klebfalle. Bei ihr findet im Gegensatz zu Drosophyllum keine aktive Tentakel- oder Blattbewegung statt. Vergleichbare passive Klebfallen sind die australische Gattung Byblis und das aus Zentral-Afrika stammende Hakenblatt (Triphyophyllum peltatum), die einen sehr ähnlichen Fangapparat entwickelt haben. Hier zeigt sich auch die konvergente Entwicklung im Pflanzenreich: besonders junge, ein- bis zweijährige Drosophyllum-Pflanzen ähneln in ihrem Habitus sehr Byblis– oder Triphyophyllum-Pflanzen. Bei den aktiven Klebfallen ist die Ähnlichkeit besonders mit dem aus den USA stammenden Drosera filiformis, dem brasilianischen Drosera spiralis oder der kubanischen Pinguicula filiformis gegeben.
Trotz des passiven Fallentyps ist Drosophyllum ein äußerst effektiver Insektenfänger. Am Standort sind die Pflanzen meist über und über mit ihrer Beute bedeckt. Ein Grund dafür ist sicher auch der extrem starke Honigduft, den Drosophyllum mittels seines Fangsekrets produziert. Dieser starke Honigduft ist unter den karnivoren Pflanzen in dieser Form einmalig. Eine weitere Besonderheit ist der hohe Anteil an Plumbagin, einer mikrobiziden Chemikalie in den Blättern von Drosophyllum. Plumbagin schützt die Pflanze wahrscheinlich vor Pilzen und Bakterien, die von den Beuteinsekten eingetragen werden.
In der Vergangenheit gab es tatsächlich eine menschliche Nutzung des Taublatts: Portugiesische und spanische Kneipenwirte sammelten große Drosophyllum Pflanzen und hängten sie über der Bar auf. Wie bei einem künstlichen Fliegenfänger wurden so die Fliegen angelockt und weggefangen. Heute ist dieser Brauch nicht mehr zu sehen, da das Drosophyllum sehr selten geworden ist.
In unserem Reisebericht Portugal erfahren Sie mehr über das Drosophyllum, seine natürlichen Standorte und seine Beute.